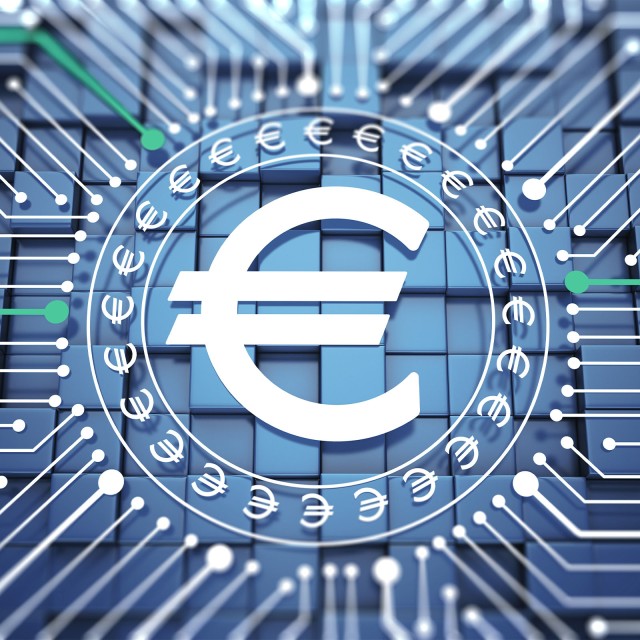26.06.2024
Europa verbessern, statt zu zerstören
Parteien von den Rändern haben bei den Europawahlen dazugewonnen. Die wirtschaftspolitischen Folgen skizziert LBBW-Chefvolkswirt Dr. Moritz Kraemer.


Standpunkt: Bei der Europawahl konnten die rechten Parteien in fast allen EU-Staaten an Wählerstimmen dazugewinnen, auch in Deutschland. Wie gefährlich ist diese Entwicklung?
Moritz Kraemer: Für Katastrophenstimmung sehe ich keinen Anlass. Die Europawahl wird oft als Denkzettelwahl missbraucht, von daher überrascht es mich nicht, dass Parteien von den Rändern des demokratischen Spektrums vergleichsweise erfolgreich waren. Viel schlimmer wäre es gerade für Deutschland, wenn diese Randparteien ihre Forderungen umsetzen könnten.
Standpunkt: Wäre Deutschland – als größter Beitragszahler – ohne Europäische Union nicht viel besser dran?
Moritz Kraemer: Deutschland hat so stark von der Europäischen Union profitiert wie kaum ein anderes Land in Europa, vor allem durch den Euro. Hätten wir weiter mit der D-Mark bezahlt, wäre diese D-Mark immer weiter aufgewertet worden. Das hätte unsere exportabhängige Wirtschaft stark belastet und das Wachstum abgewürgt. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat kürzlich durchgerechnet, dass in Deutschland bei einem Ausstieg aus EU und Euro innerhalb von fünf Jahren 2,5 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen würden. Die Wirtschaft würde um 5,6 Prozent schrumpfen. Das scheint mir sehr freundlich gerechnet, wahrscheinlich wäre die Situation sogar noch schlimmer. Man kann der deutschen Wirtschaft kaum stärker schaden als durch einen Ausstieg aus dem Euro, gerade weil wir stärker abhängig sind von Exporten als alle anderen EU-Staaten.
Standpunkt: Wissen die Unternehmen, wie sehr sie vom Euro profitieren?
Moritz Kraemer: Absolut. Für deutsche Unternehmen ist die Europäische Union der wichtigste Markt. Eben deshalb hat sich die Hälfte der deutschen Unternehmen im Vorfeld der Europawahl so offen und klar gegenüber der AfD positioniert. Mehr als zwei Drittel sehen in der AfD eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Unternehmen wissen: Ein Ausstieg aus der EU und die Einführung einer AfD-Mark wäre für die deutsche Wirtschaft sehr abträglich. Die Populisten spielen mit dem Feuer.

Man kann der deutschen Wirtschaft kaum stärker schaden als durch einen Ausstieg aus dem Euro.
Standpunkt: Kritik an der Europäischen Union entzündet sich daran, dass der Umwelt- und Klimaschutz das wichtigste Thema für die EU zu sein scheint. So ehrenwert das ist: Wurden über den EU Green Deal andere, ebenso wichtige Themen und Aufgaben vernachlässigt?´
Moritz Kraemer: Die Europawahl ist in dieser Hinsicht hoffentlich ein Weckruf. Die EU hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich immer weiter entfernt von den Menschen – und den Unternehmen. Das Bestreben, möglichst viel möglichst umfassend regulieren zu wollen, führt oft zu einer Überregulierung. Das kontrovers diskutierte europäische Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das insbesondere für Mittelständler zu einer überproportionalen Belastung führt, ist da nur die Spitze des Eisbergs.
Standpunkt: Sie glauben, dass sich der Impuls zur Überregulierung nach dieser Wahl ändern wird?
Moritz Kraemer: Die Wahlergebnisse sind ein Schlag in die Kniekehle. Sie zu ignorieren und einfach weiterzumachen… das wird nicht gehen. Das hat Brüssel übrigens auch schon vor der Wahl erkannt. Der Höhepunkt der Regulierungswut ist nach meiner Auffassung überschritten. Mich treibt die Hoffnung an, dass künftig mehr Maß gehalten wird. Und womöglich einige Regularien entschlackt werden.
Der Höhepunkt der Regulierungswut der EU ist nach meiner Auffassung überschritten.
Standpunkt: Eine mögliche Gegenreaktion könnte allerdings sein: Die Parteien der Mitte rücken enger zusammen und postulieren: Mehr Europa wagen!
Moritz Kraemer: Es ist ein durchaus realistisches Szenario, dass jetzt auf die Tube gedrückt wird, um Realitäten zu schaffen. Aber wie soll das umgesetzt, was soll erreicht werden? Eine Fiskalunion wäre eher gefährlich als sinnvoll. Und die gelegentlich diskutierten Eurobonds für die Verteidigung Europas sind ohne europäisches Militär sinnbefreit. Derlei kann man diskutieren, sicherlich, aber die Chance auf einen Konsens sehe ich dafür nicht.
Standpunkt: Wobei der Zwang zum Konsens ja einer der Gründe ist, warum es in Europa so schleppend vorangeht.
Moritz Kraemer: Die EU ist ja lernfähig, es müssen schon heute ja nicht mehr alle Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Gleichwohl ist das Treffen von Entscheidungen ein mühsamer und häufig frustrierend langsamer Prozess. Noch immer sitzen zu häufig zu viele Personen am Tisch mit Vetorecht. Was wir dabei nicht vergessen sollten: Kuhhandel gibt es nicht nur in Brüssel, das Prinzip kennen wir auch aus Berlin und aus den Ländern und Kommunen. Aber: Was ist die Alternative? Demokratische Strukturen erfordern Kompromisse.
Standpunkt: Eine effizientere Europäische Union?
Moritz Kraemer: Genau: Wir müssen daran arbeiten, Europa zu verbessern, statt zu zerstören.
Standpunkt: Wo setzen wir dabei an, um Europa zu verbessern?
Moritz Kraemer: Alle fünf Jahre zu wählen, reicht jedenfalls nicht aus. Wir müssen die Brüsseler Regulierungswut eindämmen und wir müssen die Vorteile eines geeinten Europas besser herausstellen. Das ist eines der Probleme, mit denen die EU zu kämpfen hat: Die mühsam erkämpften Errungenschaften werden nicht gefeiert, sondern als selbstverständlich gesehen. Wirtschaftlich ist die Existenz der EU ein klarer Vorteil. Ohne einen gemeinsamen Markt hätten wir nicht den Wohlstand, den wir haben. Als Volkswirt sehe ich ganz rational: Auch wenn nicht alles toll ist, ist Europa gut für uns. Aber bei Wahlen geht es leider weniger um die Ratio als um Gefühle – und da lässt uns Europa offenbar ziemlich kalt. Sonst hätten wir ein ganz anderes Wahlergebnis gesehen.